Hans Albrecht Lusznat über seine Recherchen zum Entstehen der Kameraverbände in Deutschland für das Buch Unter Kameraleuten.
Am Anfang stand die Jahreszahl 1925, an der sich vor 100 Jahren zum ersten Mal die Kameraleute zu einem Berufsverband zusammengeschlossen haben sollten. Diese Zahl wurde schon seit längerer Zeit immer wieder kolportiert, obwohl sich dafür in einer Internetrecherche keine Belege finden ließen. Diejenigen, die das Jahr 1925 ins Spiel gebracht hatten, sind inzwischen alle verstorben. Die ältesten heute noch lebenden Kameraleute sind erst in der Nachkriegszeit gegen Ende der 1950er Jahre in den Beruf gestartet und können daher das damals schon gut 30 Jahre zurückliegende Gründungsereignis nur aus den Erzählungen der Altvorderen kennen.

© Guido-Seeber-Archiv, Deutsche Kinemathek
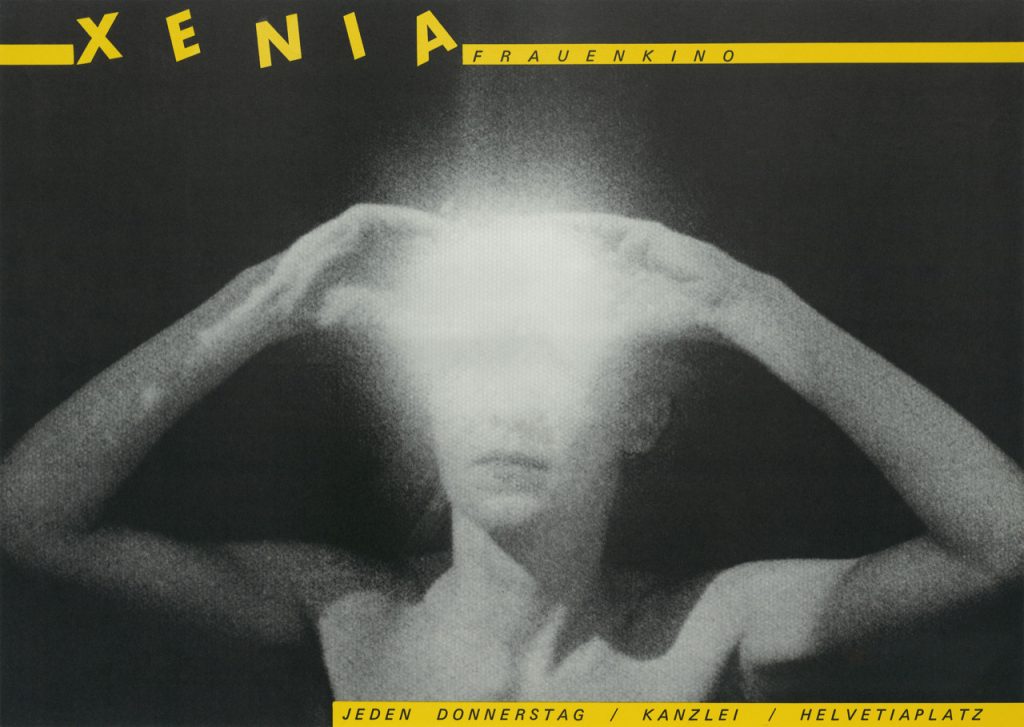
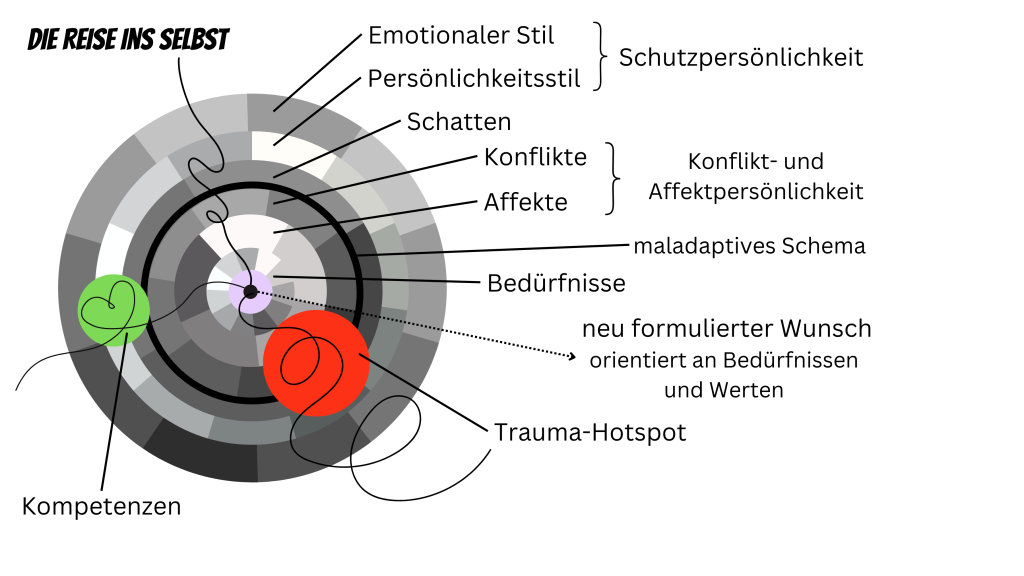



Neueste Kommentare